Noch ein Nachwenderoman aus der Provinz
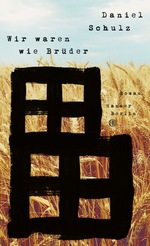
- Buchautor_innen
- Daniel Schulz
- Buchtitel
- Wir waren wie Brüder
Waren wir nicht alle mit Nazis befreundet? (Noch) ein Roman über fest verschlossene Augen, Kompromisse und ein Coming of Age.
In seinem autobiografischen Debutroman beschreibt Daniel Schulz das Aufwachsen als Jugendlicher in der Wendezeit in der brandenburgischen Provinz. Es geht um jugendliche, zumeist männliche Freundschaft, die Schulzeit, das Verhältnis zu den Eltern, das Verhältnis zum alten und neuen Staat, die massiven gesellschaftlichen Veränderungen, aber auch das Verliebtsein – und immer wieder Gewalt. Schulz hat das Aufblühen der so genannten Baseballschlägerjahre im wahrsten Sinne des Wortes hautnah miterlebt und könnte so zu einem guten Chronisten ebenjener Jahre werden. 30 Jahre nach dem Mauerfall scheint es, dass sich ein kollektives Gedächtnis über die Nachwendejahre etabliert hat. Von dem Untergang der DDR überrumpelt, nachdem man in ihr als Kind eigentlich gut klargekommen war, tauchen Nazis wie aus dem Nichts auf und dominieren den Alltag. Der Roman „Wir waren wie Brüder“ bedient diese Allgemeinplätze und das funktioniert, weil wir Klischees und Vorannahmen so unglaublich gut verinnerlicht haben und daran glauben wollen.
Aufwachsen
Der Einstieg in das Buch ist – abgesehen von dem Vorgriff, der uns erklärt, dass es um keine schöne Erinnerung geht – ähnlich den Büchern, die seit einiger Zeit über die Nachwendejahre in der Provinz geschrieben wurden, wie Grit Lemkes „Wir Kinder von Hoy“ oder Manja Präkels „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“. Die eigentliche Geschichte beginnt kurz vor dem Untergang der Deutschen Demokratischen Republik: mit einer aus Kindersicht positiven Bezugnahme auf den Sozialismus und vielleicht auch auf die DDR. Wobei schnell deutlich wird, dass sich die Kinder durchaus innerhalb des Systems sehen, man könnte hämisch behaupten, dass die Propaganda auch bei Kindern gut funktionierte: „Wenn ich mir vorstelle, dass der Westen gewinnt, wird es in meinem Magen ganz heiß.“ (S. 17) Durch die gewählte Darstellung einer glücklichen Kindheit und der Angst vor dem Westen wird aber auch die drastische Veränderung, die durch den Mauerfall alle Lebensbereiche und Familien betraf, herausgestellt. Der Protagonist und seine Kinderfreund*innen haben tatsächlich Angst vor dem westlichen Imperialismus und der Vereinnahmung der DDR durch den Westen. Mit reichlich DDR-Insidern und -Vokabular gespickt, setzt das Buch die Messlatte des Lesevergnügens hoch. Das liegt auch daran, dass literarische Größen wie Stokowski und Kapitelman sich in lobenden Tönen über den Roman äußern.
Der Roman ist in kurze, fast möchte man meinen knappe Kapitel gegliedert, die nicht unbedingt zusammenhängen, letztlich aber ein großes Ganzes ergeben und eine Kindheit und Jugend in der Brandenburger Provinz schildern. Die Erzählung ist zwar individuell – beispielsweise war es zu DDR-Zeiten eher unüblich, einen ranghohen NVA-Offizier als Vater und eine überzeugt praktizierende Protestantin als Mutter zu haben – trotzdem ist der Lebensweg an sich eher beispielhaft für einen von vielen in dieser Zeit. Es bleibt unklar, ob die Szenen, die beschrieben werden, nur in Brandenburg hätten spielen können. Die Gewalt in der Schule, der Klassenhass, der bereits bei den jungen Schüler*innen sichtbar wird bei der Frage, wer aufs Gymnasium geht und wer nicht, die Konkurrenz, Gemeinheit und Prügelei auf dem Schulhof: All das ist weder eine Besonderheit Brandenburgs noch der Nachwendezeit. Die Besonderheit ist vielleicht, in welchem Ausmaß und Häufigkeit rassistisches und antisemitisches Vokabular bedient wird. Zwar ist dem Buch eine Triggerwarnung vorangestellt, die leicht zu überlesen ist – doch es bleibt fraglich, welchen Mehrwert die Reproduktion dieser Sprache hat.
Gewalt ohne Namen
Dass ein Buch über die gewaltvolle Nachwendezeit nicht ohne gewaltvolle Darstellungen auskommt, scheint klar. Unklar ist manchmal, wann es sich um die allgemeine Gewalt der Gesellschaft und eines Umbruchs und wann um neonazistische Gewalt handelt. So zum Beispiel die Szene einer Demütigung eines Kindes, sehr wahrscheinlich durch einen Nazi. Allerdings ist die einzige Beschreibung der Person: „Auf seinem rechten Arm steht etwas in alter Schrift […]. ‚Tannenberg’ steht da.“ (S. 46). Hier wird exemplarisch deutlich, was sich durch das gesamte Buch zieht: eine Szene, die vor allem durch eine vage Beschreibung der Beteiligten und die Vorannahme der lesenden Person zu einer Erzählung neonazistischer Gewalt wird. Es wird etwas ungreifbar Schlimmes transportiert, das nicht weiter definiert wird. Die tief sitzende Angst, die solche Szenen in ihrer Unbegreiflichkeit und Absurdität bei den Kindern und Jugendlichen entfachen, wird sehr explizit geschildert. Durch den Allgemeinplatz, „alles Nazis im Osten“ wird diese Gewalt vermeintlich verständlich, verliert aber ihre Spezifik. „Was ist Angst? […] Was ist Verrat?“ (S. 45) Die Frage wird nicht aufgeklärt, aber die Angst, die bleibt trotzdem.
Die konkrete Beschreibung von Nazis kommt relativ spät. Bei der Bezeichnung der „Kinderglatzen“ beispielsweise wird sichtbar, dass Nazis eine solche Normalität sind, dass schon der Nachwuchs sich anpasst. Das lässt aufhorchen, mehr aber auch nicht. Die Region des Gehirns, die Vorannahmen bestätigt sieht, ist mit dieser lapidaren und knappen Beschreibung befriedigt.
Eine Stärke des Buches hingegen ist, dass die Feinheiten der Misere der Nachwendezeit erzählt werden. Und zwar unaufgeregt, fast schon nebenbei: der Krebs derjenigen, die nach der Wende arbeitslos wurden und sich tot gesoffen haben, der Streik der Arbeiter*innen in Bischofferode, die Verzweiflung derer, die sich nur noch durch den Freitod zu helfen wussten.
Coming of Age
Eine sehr zentrale Rolle nimmt die mehr oder weniger unerwiderte Liebe des Protagonisten ein: Mariam wird als „Werwolfina“ (S. 51) eingeführt. Sie spielt mehrere Rollen: das toughe Girl, die es schafft, auch die hart gesottenen Jungs in die Schranken zu weisen; die mysteriöse Fremde, die durch die Beschreibung ihres Aussehens und ihres Temperaments exotisiert wird; das Objekt der Begierde eines Teenagers, aber auch die Fremde, die anders ist als die anderen Jugendlichen der Brandenburger Provinz. Die Figur, die Mariam spielt, ist mehr als unangenehm: Sie zeigt einmal mehr, dass Frauen keine Rolle gespielt zu haben scheinen, außer den Muttis, die am Rand als diejenigen erscheinen, die die Wäschekörbe und Aufträge verteilen. Mariam wird als eine Person dargestellt, die die Beschreibung „Klischee“ in jeder Hinsicht verdient: als exotisierte Person, die über ihre Herkunft – die anders sein muss als die der anderen – ungenaue Auskunft gibt. Als unabhängige Frau, die sich am Ende ein bisschen fies aus der Beziehung stiehlt (die schlussendlich dann doch noch kurz eingegangen wird). Als eine der wenigen weiblichen Personen im Buch, die eine zentrale Rolle spielt und die das vor allem durch einen rabiaten Auftritt und schlechte Kommunikation schafft. Ein bisschen habe ich mich beim Lesen betrogen gefühlt: Wollte ich einen Roman über die Nachwendezeit lesen, meinetwegen auch mit allem was dazugehört, habe ich eine durchgenudelte Kitschromanze bekommen, der vor Allgemeinplätzen und Klischees nur so trieft. Das traurige ist, dass Daniel Schulz in einem Podcast zu seinem Buch sagt, dass er genau das will: „Ein bisschen Romantik muss sein“.
Der Horror der Nazis
Das gesamte Buch hindurch werden vereinzelte Szenen geschildert, bei denen die Menschenverachtung der „Freunde“ des Protagonisten klar wird. Unverständlich bleibt, warum er daneben sitzt und nichts tut. Ist es die viel zitierte Angst? Nein, denn die wird an anderer Stelle schonungsloser, ehrlicher und eindringlicher beschrieben. Es erscheint, dass es die Normalität des Ganzen ist, die Alternativlosigkeit. Doch es werden auch immer wieder kleinere Situationen geschildert, die anmuten, der Protagonist sei ein Held. Oder sich als Linker sieht? Es wird letztlich nicht ersichtlich, warum der Protagonist sitzen bleibt, wenn Auschwitz in Frage gestellt wird, die einzigen Schwarzen Jugendlichen des Dorfes beleidigt werden, die Reichen aus Zehlendorf (woher kommen die eigentlich auf einmal, warum werden sie Buletten genannt und was genau machen die?) sich rassistisch über Kreuzberg auslassen.
Der Roman von Schulz hat Potenzial – das leider nicht genutzt wird. Die Kapitel sind zu kurz, immer, wenn man gerade das Erzählte durchdringen will, ist auch schon wieder Schluss mit der Erzählung. Das ist schade, denn dadurch verharren sie in den genannten Allgemeinplätzen, muss viel hinzu interpretiert oder sich der Feuilletons der letzten Jahre bedient werden. Dadurch wirkt der Roman wie ein Verstärker dieser Erzählungen und Klischees. Die Reflexion der eigenen Rolle kommt dabei genauso zu kurz wie eine irgendwie geartete Erklärung. Die jedoch wird erwartet, weil so oft die Erzählung weniger literarisch als vielmehr Oberlehrer*innenhaft daherkommt. Es erscheint, dass der Autor die eigene Enttäuschung über sich selbst verarbeiten wollte.
Das Buch könnte ein weiterer Beitrag sein zum Verständnis über die ostdeutsche Provinz und der fast selbstverständlichen Etablierung von Nazistrukturen, vor allem aber der Naivität und dem Nicht-Wahrhaben-Wollen. Leider lässt der Roman den roten Faden vermissen und damit auch eine Stringenz, die für das Verstehen vonnöten gewesen wäre. Am Ende des Buches erscheinen die Protagonist*innen nach wie vor farblos und austauschbar, es gelingt auf knapp 300 Seiten nicht, ihnen das Leben einzuhauchen, was für einen Roman nötig wäre, den man mit Spannung liest.
Obwohl es laut Klappentext des Buches um das Jahrzehnt nach der Wende und die Nazistrukturen in der brandenburgischen Provinz gehen soll, fühlt es sich eher an wie ein Coming-of Age-Roman, bei dem wir dem Protagonisten beim männlichen Pubertieren zugucken müssen und bei dem zufälligerweise Nazis auch eine Rolle spielen. Die Stärke des Romans liegt darin, dass der Autor ehrlich ist: Ja, ich habe mit Nazis gehangen, ja ich hatte Angst, ja, ich war ein Teil davon. Genau das zeigt ein wichtiges Problem – welches aber durch die Lektüre von „Wir waren wie Brüder“ nur in Teilen verständlicher wird und durch die Lektüre der anderen, besseren Romane über die Nachwendezeit ergänzt werden muss.
Wir waren wie Brüder.
Hanser Verlag, Berlin.
ISBN: 978-3-446-27107-4.
288 Seiten. 23,00 Euro.