„Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade“
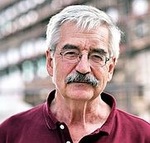 © medico international
© medico international
- Interviewpartner_innen
- Interview mit Thomas Gebauer
Egal ob effektiver Altruismus oder Crowdfundingkampagnen: Private Mildtätigkeit stärkt den neoliberalen Kapitalismus. Eine echte Daseinsvorsorge braucht einen kritischen Begriff von Solidarität – und eine globale Perspektive.
Herr Gebauer, blicken wir auf die Welt, wie sie ist, sehen wir überall Krieg und Armut. Um die Not zu lindern, gibt es immer neuere Formen der Hilfe. Besonders schillernd ist der sogenannte „Effektive Altruismus“, bei dem es darum geht, Initiativen zu unterstützen, die besonders effektiv Menschen helfen. Wird dadurch die Welt eine bessere?
Wohl kaum! Und schon gar nicht, wenn das Ziel die Verwirklichung universeller Menschenrechte sein soll. Im „Effektiven Altruismus“, einer skurrilen Mischung aus Philosophie und Finanzökonomie, wird die Entpolitisierung zum Dogma erhoben. Die Vordenker gehen davon aus, dass Not nur durch Hilfe abgefedert, nicht aber ihre strukturellen Ursachen beseitigt werden können. Die werden bei allen Überlegungen einfach ausgeblendet.
Inwiefern?
Deutlich wird das am Beispiel des „Charity Evaluator“, der von zwei New Yorker Hedgefonds-Analysten entwickelt worden ist. Mit einschlägigen Kosten-Nutzen-Analysen berechnen sie, wie am effektivsten geholfen werden kann. So setzen sie die eingesetzten Mittel in Beziehung zu dem verlängerten Lebenszeitraum eines Menschen und kommen zu dem Ergebnis, dass die effektivste Hilfsorganisation die „Against Malaria Foundation“ ist, die für die Rettung eines Menschenlebens etwa 2.300 US-Dollar aufwendet. Doch was macht man mit Menschen, deren Rettung vielleicht mehr Geld erfordert? Was macht man mit allen Formen von Prävention, um Menschen dabei zu helfen, gar nicht erst in bedrohliche Situationen zu kommen? Das alles lässt sich mit solchen Berechnungen und dieser Form der Wirkungskontrolle nicht erfassen.
Ab wann gilt etwas als effektiv?
Ich habe Vertreter des „Effektiven Altruismus“ mal gefragt, ob sie bereit wären, uns bei der Bekämpfung von Anti-Personen-Minen zu unterstützen. Sie haben es schlichtweg abgelehnt.
Mit welcher Begründung?
Weil eine solche Kampagne ihr Ziel ja nicht erreichen könnte, also unwirksam bleibt. Weil man womöglich keine raschen und messbaren Erfolge nachweisen kann. Wir haben schließlich Jahre gebraucht, um das Verbot von Anti-Personen-Minen durchzusetzen. Die Alternative wäre gewesen, es dabei zu belassen, den Opfern Prothesen zu geben. Mit dieser Art des Helfens, die wir auch geleistet haben, verschwindet die Möglichkeit, tatsächlich verändernd in die Strukturen einzugreifen.
Das Konzept scheint aber zu funktionieren. Viele machen mit beim „Effektiven Altruismus“.
Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie so Gutes tun. Man überlegt, wie man sein Einkommen ausgibt, ohne zu fragen, wie es zustande kommt. Ganz abstrus wird es, wenn es darum geht, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Eine Spielart des „Effektiven Altruismus“ ist das earning to give. Demnach soll man möglichst viel Geld verdienen, um möglichst viel Gutes tun zu können. Die Helden des modernen Helfens sind dann Börsenspekulanten.
Aber was spricht dagegen, wenn Menschen viel Geld für Moskitonetze springen lassen, damit weniger Leute sterben?
Es ist immer eine Frage dessen, was man erreichen möchte. Wenn es darum geht, Not und Unmündigkeit nachhaltig zu überwinden, dann hilft pure Wohltätigkeit nicht weiter. Wenn wir am Ziel der Schaffung sozialer Gerechtigkeit festhalten wollen, bedarf es auch der politischen Intervention. Wer dieses Ziel aufgibt und das Unrecht bestenfalls ein bisschen abfedern möchte, für den ist der „Effektive Altruismus“ vielleicht vernünftig.
Neben dem „Effektiven Altruismus“ sind Crowdfunding-Kampagnen wie GoFundMe aus den USA beliebt. Menschen stellen Aufrufe ins Internet und hoffen, damit genug Geld zu erhalten, um Arztrechnungen, Schulgeld oder Kosten für die Beerdigung eines Verwandten zahlen zu können. Warum ist die private Mildtätigkeit gerade in den USA so verbreitet?
Spendenplattformen wie GoFundMe haben in den USA deshalb eine so große Bedeutung, weil es dort keine systematische und verlässliche soziale Daseinsvorsorge gibt. Wo Menschen keinen Zugang etwa zur Krankenversicherung oder zu öffentlich finanzierten Bildungseinrichtungen haben, bleibt ihnen keine andere Wahl. Inzwischen aber nehmen solche Spendenplattformen auch in Deutschland zu.
Warum?
Sie versprechen Nähe und unmittelbare Solidarität. Dabei wird aber übersehen, dass es Menschen gibt, die gar nicht imstande sind, einen Aufruf zu formulieren, oder die an einer Not leiden, die sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollen. Die Anonymität von sozialen Sicherungssystemen, so wie wir sie kennen, ist etwas sehr Wertvolles. Sie sichert ein Anrecht auf Unterstützung, ohne sich entblößen zu müssen. Das schützt vor Diskriminierung und garantiert auch individuelle Freiheiten. Solche Grundsätze gehen verloren, wenn Not und Hilfe auf dem Marktplatz des Internets verhandelt werden.
Auch wenn soziales Crowdfunding als etwas Neues erscheint, ist es also eher ein Rückfall hinter institutionalisierte Solidarität?
Es ist sogar ein Rückfall hinter die Zeit der Französischen Revolution, hinter die Idee der Menschenrechte. Der Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi, ein Zeitgenosse der Französischen Revolution, soll mal den wunderbaren Satz gesagt haben: „Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade.“ Wir sind auf dem besten Weg, genau diese Form des Ersaufens von grundlegenden Rechten wieder hoffähig zu machen. Recht ist immer etwas Abstraktes. Rechte haben auch die, die wir nicht kennen und sehen. Wir opfern diese Form des Rechtsanspruchs, wenn wir solidarisches Handeln aus seiner Absicherung durch gesellschaftliche Institutionen herauslösen.
Strukturelle Ursachen sind aber schwerer zu beseitigen. Ist da der Wunsch nach einer konkreten Hilfe nicht nachvollziehbar?
Natürlich ist es wichtig, sich zu engagieren und für die unmittelbare Beseitigung einzelner Missstände zu sorgen. Dabei aber muss immer klar sein, dass für nachhaltige Lösungen mehr notwendig ist. Ich will das am Beispiel eines Projektes aus Südafrika erläutern. In der Provinz Limpopo waren die Toiletten einer Grundschule in einem so schlechten Zustand, dass Kinder darin umgekommen sind. Das mussten und wollten die Eltern zusammen mit den Lehrern ändern. Section 27, eine Partnerorganisation von medico, hat sich eingeschaltet. Der Name bezieht sich auf Artikel 27 der südafrikanischen Verfassung, in dem das Recht auf Gesundheit festgeschrieben ist. Section 27 hat nicht das gemacht, was womöglich viele Hilfsorganisationen getan hätten, nämlich Geld bereitzustellen, damit die Leute in Eigenverantwortung die Toiletten reparieren können. Stattdessen haben sie die Eltern und Lehrer darin unterstützt, sich als politische Akteure zu Wort zu melden, um auf die Schulverwaltungen Druck auszuüben, damit sie endlich ihren Pflichten nachkommen und für die Instandsetzung der öffentlichen Gebäude sorgen.
Hat das funktioniert?
Nicht sofort. Weil die Kampagne die Untätigkeit der Provinzregierung publik gemacht und dabei auch die Korruption thematisiert hat, sind einige der Aktivisten sogar mit dem Tode bedroht worden. Aber am Ende haben sich die Leute durchgesetzt. Und es wurden nicht nur die Toiletten in der einen Schule, sondern in allen Schulen der Provinz instand gesetzt.
Was unterscheidet Section 27 von einer NGO, die den Betroffenen direkt Geld zur Instandsetzung der Toiletten gegeben hätte?
Das ist ein anderer Ansatz. Es ist eine Hilfe, die den Leuten vor Ort bei ihren Auseinandersetzungen mit den gesellschaftlich Mächtigen, in diesem Fall der Verwaltungsmacht, zur Seite steht und auf eine gesellschaftliche Verantwortung pocht. Für intakte Schulgebäude und Bildung zu sorgen, liegt nicht in privater Verantwortung, sondern in öffentlicher. Es wäre ein Fehler, nicht auf dieser öffentlichen Verantwortung zu bestehen. Nur so lassen sich die Menschenrechte verwirklichen.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang von der Ambivalenz der Hilfe. Was meinen Sie damit?
Hilfe ist immer etwas Zweischneidiges. Zweifellos ist es notwendig, Menschen, die Hunger leiden, mit Nahrungsmittelspenden beizustehen. Gleichzeitig aber trägt eine solche Hilfe auch dazu bei, bestehende Ungleichheit zu stabilisieren. Hilfe, die soziales Unrecht nur abfedert, schafft noch keine Veränderung der strukturellen Bedingungen von Not und Unfreiheit.
Sie sind aktiv bei der Hilfsorganisation medico. Tragen Sie damit auch zur Stabilisierung der Verhältnisse bei?
Wir haben aus solchen Grundüberlegungen heraus einen kritischen Begriff von Hilfe entwickelt, der Hilfe zugleich verteidigt und zu überwinden versucht. In Zeiten gesellschaftlicher Entsolidarisierung ist es notwendig, auf unmittelbare Hilfen, etwa für Menschen, die zu uns geflohen sind, zu bestehen. Aber es muss eben auch darum gehen, die Ursachen von Flucht und aufgezwungener Migration aus der Welt zu schaffen. Letztlich geht es darum, wohltätige Hilfe durch verlässliche Formen von institutionalisierter Solidarität überflüssig zu machen.
Was unterscheidet Hilfe von Solidarität?
Hilfe ist eine spezielle Form von Solidarität, man unterstützt sich gegenseitig in Situationen von Bedürftigkeit. Solidarität aber ist mehr: Sie zeigt sich nicht nur im gemeinsamen Kampf für gerechte Verhältnisse, sondern ist selbst ein Ziel. Solidarität verlangt nach gesellschaftlichen Institutionen, die für Ausgleich und Teilhabe und damit für ein würdevolles menschliches Zusammenleben sorgen. Die Französische Revolution wusste um die Bedeutung von Solidarität. Neben Freiheit und Gleichheit verlangte sie bekanntlich auch das, was die Revolutionäre damals Brüderlichkeit nannten. Übersetzen wir „Fraternité“ zeitgemäß mit „Gesellschaftlichkeit“, wird die immense Bedeutung, die in dieser Forderung steckt, klar. Es geht nicht um soziales Gedöns, wie es neoliberale Politiker gerne verstanden wissen wollen, sondern um etwas, das durch den Neoliberalismus fast komplett zerstört worden ist – die Erkenntnis, dass es gesellschaftlicher Institutionen bedarf, um Freiheit und Gleichheit zu sichern. Solidarität ist weit mehr als das Gefühl innerer Verbundenheit. Solidarität steht für die Verpflichtung aller, für das Ganze einzustehen.
Solidarität ist ein schillernder Begriff. Linke verwenden ihn ebenso wie Rechte und Neoliberale – und alle verstehen etwas anderes darunter. Ist es deshalb überhaupt sinnvoll, sich auf einen Begriff zu beziehen, der eine so unklare Bedeutung hat?
Gerade weil der Begriff der Solidarität mitunter missbraucht wird, ist die Entfaltung eines kritischen Verständnisses notwendig. Eines, das aufzeigt, wie problematisch die neoliberale Überhöhung von Freiheit ist. Vielen Menschen hat die Aufkündigung von Gesellschaftlichkeit nicht ein Mehr an Freiheit, sondern nur eine Art Vogelfreiheit gebracht. Inzwischen ist die soziale Verunsicherung – wir können auch sagen: Ent-Sicherung – von Menschen zum Weltrisiko Nummer eins geworden.
Daraus versuchen derzeit die rechten Kräfte Kapital zu schlagen und appellieren an eine exklusive Solidarität. Was unterscheidet die exklusive Solidarität von einer linken?
Nehmen wir das Beispiel Polen, wo die PiS-Partei im Oktober erneut Wahlen gewonnen hat. Zustimmung erfuhr die politische Rechte nicht zuletzt deshalb, weil sie sich für öffentliche Daseinsvorsorge starkgemacht hat. Sie tat das allerdings in Abgrenzung zu anderen und bediente so rückwärtsgewandte Ressentiments. In den Vorstellungen der Rechten ist Solidarität nur in möglichst homogenen Gemeinschaften möglich, in denen das Fremde keine Rolle spielt. Was die politische Linke dem entgegenzusetzen hätte, ist eine kosmopolitische Idee von Solidarität. Eine, die darum weiß, dass die großen Probleme der Zeit, der Klimawandel, die Zunahme von Konflikten, die weltweite Armut, nur im globalen Kontext gelöst werden können. Wer meint, solche Probleme durch Abschottung lösen zu können, irrt.
Die Fraternité, die Brüderlichkeit in der Französischen Revolution, lässt sich auch interpretieren als Zusammenschluss der Brüder gegen den König. Braucht es für die Solidarität ein Außen, gegen das man sich solidarisiert?
Dieses Argument hat mir nie eingeleuchtet. Solidarität hat etwas mit der Verwirklichung von Menschenrechten zu tun, und deren Grundsatz ist die Universalität. Mag sein, dass diesem Grundsatz feudale Strukturen entgegenstehen, aber ein Außen als solches braucht Solidarität explizit nicht. Das Außen kommt erst ins Spiel, wenn die Idee universeller Rechte auf das Bemühen um Sicherheit reduziert wird. Das ist gegenwärtig der Fall. Sicherheit ist etwas, das man auch partikular, etwa durch Abschottung, realisieren kann. Das Recht dagegen ist dem Anspruch nach immer universell.
Internationale Klassensolidarität lebt auch vom Austausch mit Beschäftigten im Globalen Süden. Ich kann mich mit einer Textilarbeiterin aus Bangladesch leichter solidarisch erklären, wenn ich eine konkrete Person vor Augen habe. Sind Austausch und Nähe Voraussetzungen für Solidarität?
Begegnungen zwischen Menschen helfen, das Gemeinsame herauszufinden und zu erkennen. In Städtepartnerschaften oder auch dem Austausch, den Kirchen organisieren, liegt eine Menge Kraft. Aber noch mal: Das Prinzip ist, dass wir am Ende auch solidarisch sind mit Menschen, die wir nicht kennen. Die Menschenwürde für alle zu verwirklichen, erfordert eine Abstraktionsleistung, die über das konkrete und unmittelbare Erleben hinausgeht.
Aber lässt sich konkrete Solidarität im Lokalen leichter organisieren?
Das Globale steht im Verhältnis mit dem Lokalen. Um beispielsweise sinnvolle gesundheitliche Prävention betreiben zu können, brauchen lokale Zusammenhänge nicht nur eigene Entscheidungsbefugnisse, sondern auch die entsprechenden Mittel. Die können durchaus zentral zusammengetragen werden. Durch Institutionen, die etwa Steuern einnehmen und dafür sorgen, dass notwendige gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Die Frage hingegen, was mit den Mitteln geschehen soll, muss möglichst weit unten in kleineren Zusammenhängen beantwortet werden. In Skandinavien entscheiden die Kommunen über die Prioritäten bei der gesundheitlichen Prävention. Soll das Geld in den Bau einer neuen Sporthalle fließen, in einen neuen Trimm-dich-Pfad oder in Ernährungsberatung an Schulen? Aber ohne einen übergreifenden solidarischen Finanzausgleich wird auch im Lokalen nur wenig zu entscheiden sein.
Was heißt das jetzt übertragen auf die globalen Verhältnisse?
Seit Jahren mache ich mich für eine globale Bürgerversicherung stark. Weltweit gesehen sind genug Mittel da, um allen Menschen der Welt den Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Es scheitert nicht am Mangel an Ressourcen, nicht am Wissen, sondern nur an der Bereitschaft, den Ausgleich zu realisieren. Es ist eine Frage der Politik, aber auch eine Frage der Öffentlichkeit, sich bereit zu erklären, auch für die Gesundheitsbedürfnisse von Menschen in Südasien oder in Afrika einzustehen. Noch sind wir weit von der Einsicht in die Notwendigkeit eines solchen globalen Austauschs entfernt. Die Idee internationaler Solidarität, von der wir früher so oft gesprochen haben, muss heute inhaltlich neu bestimmt werden.
Kann der Staat die Rolle einer zentralen Stelle einnehmen?
Ich spreche mit Absicht nicht von staatlichen Institutionen, sondern von gesellschaftlichen. Mir geht es nicht darum, Nationalstaaten das Wort zu reden, sondern einer gesellschaftlichen Verantwortung, die sich in gesellschaftlichen Institutionen materialisiert. Das müssen nicht zwangsläufig staatliche Institutionen sein.
Sondern?
Austausch und die Teilhabe können auch über gesetzlich geregelte Selbstorganisationen ermöglicht werden. In unserem Krankenversicherungssystem ist das trotz aller Mängel als Prinzip angelegt. Es wäre eine Aufgabe linker Politik, statt nur die bürokratische Verkrustung solcher Institutionen zu kritisieren, für deren Demokratisierung zu sorgen, sie sozusagen zu vergesellschaften. Nur so kann die Einflussnahme mächtiger Akteure wie der Pharmaindustrie zurückgedrängt und können die Bedürfnisse und Rechtsansprüche der Patientinnen und Patienten ins Zentrum gestellt werden.
Braucht es für eine tatsächliche Verwirklichung der Solidarität eine andere Wirtschaftsform?
Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung für Solidarität. Daseinsvorsorge verträgt sich nur bedingt mit profitorientierten und auf Wachstum ausgerichteten Geschäftsinteressen. Gemeingutökonomien funktionieren nur, wenn die vorhandenen Mittel weder unter- noch übergenutzt werden. Was das bedeutet, kann nicht den Opportunitätsüberlegungen privater Kapitalanleger überlassen bleiben. Im solidarischen Ausgleich treten Menschen zueinander in Beziehung und unterstützen sich gegenseitig. Das Solidaritätsprinzip bedeutet, den Rechtsansprüchen auch derer zu entsprechen, die sich den Zugang zu Bildung oder Gesundheit aus eigener Kraft nicht leisten können. Mit der Privatisierung von Daseinsvorsorge, die in den Ländern des Südens viel weiter vorangeschritten ist als hier, werden aber genau die ausgeschlossen, die Daseinsvorsorge am dringendsten bräuchten: die Armen und Mittellosen. Gemeingüter lassen sich nur außerhalb der Sphäre kapitalistischen Wirtschaftens verwirklichen.
Wenn das Ende des Kapitalismus eine Voraussetzung für verwirklichte Solidarität ist, stellt sich die Frage, wie dieses Ende herbeigeführt werden kann. Momentan sprechen viele über Klasse und Klassenkampf. Ist die Klassensolidarität, die sich explizit gegen den Kapitalismus und die Kapitalseite richtet, ein Mittel zur Überwindung des Kapitalismus?
Ich bin nicht sicher, ob die Begriffe „Klasse“ und „Klassenkampf“ weiterhelfen. Es geht vielmehr um die Frage nach dem revolutionären Subjekt. Wo sind die Kräfte, die der sozialökologischen Verwüstung der Welt Einhalt gebieten können? Das ist sicherlich nicht das herkömmlich gedachte Proletariat, und es sind auch nicht nur die Marginalisierten und Ausgegrenzten, sondern auch Mittelschichten und Intellektuelle. Das, was für die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse notwendig ist, ist sehr vielschichtig. Revolution muss man sich heute eher als Bündel von Initiativen vorstellen, die in ihrem Umfeld notwendige Veränderungen vorantreiben. Da geht es um das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, um unsere Beziehung zur Natur, um die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebens- und Produktionsweise, um Fragen der Macht. Das Problem ist, dass heute viele der Initiativen, die sich für eine sozialökologische Transformation engagieren, eher isoliert für sich und nicht aufeinander bezogen arbeiten. Noch fehlt es an einer gemeinsamen, die globalen Zusammenhänge berücksichtigenden Strategie.
Genau das ist eine der Ausgangsüberlegungen einer Klassenpolitik auf der Höhe der Zeit. Damit verbindet sich die Hoffnung, die Partikularisierung linker Politik hinter sich zu lassen, wieder zu etwas Universellem zu kommen.
Dafür braucht es vor allem die Verständigung auf Grundprinzipien. Hier spielt der Antikapitalismus durchaus eine wichtige Rolle. Nehmen wir die nachhaltige Entwicklungsagenda der UN mit ihren 17 Zielen und 169 Unterzielen. Eine wunderbar klingende Programmatik, die scheinbar nichts auslässt. Viele NGOs waren hochzufrieden, dass sie ihr jeweiliges Ziel unterbringen konnten – in der Freude ist das eigentliche Problem aus dem Blick geraten: In den Ausführungsbestimmungen steht, dass für die Verwirklichung der Ziele die Länder jeweils selbst verantwortlich seien und deshalb zuallererst für Wachstum zu sorgen sei. Von einer gerechten Verteilung vorhandener Ressourcen ist dagegen nicht die Rede. Letztlich wird mit dieser Agenda eine Quadratur des Kreises versucht. Wie aber kann mit einer zerstörerischen Produktionsweise die Umwelt gerettet und wie mit einem System, das systematisch Armut produziert, die Armut aus der Welt geschafft werden? Nachhaltige Veränderung gelingt nur, wenn wir das Ganze im Blick behalten.
Braucht es dafür eine Utopie?
Es geht um die Entwicklung von Ideen, die wir der Zerstörung entgegenstellen können. Wir müssen deutlich machen, dass es anders geht. Dafür bedarf es auch einer Vision von Gesellschaftlichkeit im globalen Kontext. Eine, die nicht mehr von Konkurrenz und dem Streben nach privatem Profit getragen wird, sondern von der gegenseitigen Sorge und der gemeinsamen Verantwortung für das Ganze, von Solidarität.
**
Thomas Gebauer, 64, ist Soziologe, Psychologe und Menschenrechtsaktivist. Er arbeitet seit gut 40 Jahren im Bereich der internationalen Hilfe, war viele Jahre Geschäftsführer der Hilfsorganisation medico international. Heute ist er Sprecher der Medico-Stiftung. Er hat Anfang der 1990er Jahre die „Internationale Kampagne zum Verbot von Landminen“ initiiert, die 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Das Interview führte Sebastian Friedrich