Das Ende des Plattenbau-Paradieses
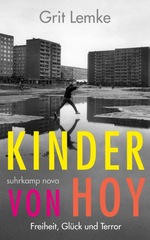
- Buchautor_innen
- Grit Lemke
- Buchtitel
- Kinder von Hoy
- Buchuntertitel
- Freiheit, Glück und Terror
Ein eindrücklicher Roman über Hoyerswerda, das Pogrom 1991, das Leben in der DDR und deren Ende.
In der DDR stand Hoyerswerda für Zukunftsoptimismus, später wurde die sächsische Stadt zum Symbol für den Untergang der DDR. Grit Lemke, Jahrgang 1965 und selbst Hoyerswerdsche, hat ein Buch über die Brüche der Wendezeit und die „Baseballschlägerjahre“ geschrieben. Doch es geht nicht allein um den Terror dieser Jahre, den Schwerpunkt des autobiografischen, dokumentarischen Romans bilden die etwa zwanzig Jahre bis zum Ende der DDR.
Das Leben im Kollektiv
Mit dem Ausbau der Energiewirtschaft durch das VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe, schlicht die „Pumpe“ genannt, wird in den 1960er Jahren auch das Projekt „Sozialistische Stadt“ in Hoyerswerda gestartet, um dem Zuzug von Arbeiter*innen gerecht zu werden. Schnell ist „Hoy“, wie Hoyerswerda vor Ort bezeichnet wird, die kinderreichste Stadt der DDR: „Denn nichts weniger als eine frohe Zukunft verhieß das neu erbaute Gaskombinat“ (S. 9).
Familien und junge Leute beziehen in Scharen die Neustadt, wo Wohnkomplex (WK abgekürzt, WeKah genannt) neben Wohnkomplex entsteht. Mit dem Einzug der „Kinder von Hoy“ in die neue Stadt beginnt auch das Buch: Lemke beschreibt das Alltags- und Schulleben, die Fahrt im Schichtbus „erste, zweete, dritte Welle“ (S. 11) und ebenjene WKs, die gebaut werden, wo die Kinder kollektiv erzogen werden, wo „ein allumfassendes, gemeinsames Sorgerecht“ (S. 19) gilt. Notgedrungen durch die Schichtbarbeit der Erwachsenen – schließlich arbeiteten alle in „Pumpe“ – übernehmen Erzieher*innen, ältere Geschwister oder Nachbarskinder Aufgaben der Kindererziehung. Allgegenwärtig sind die „Kittelschürzen“, also die anderen Mütter, die nach ihren Dederonschürzen benannt sind, bei denen man ebenso Trost und Geborgenheit findet, vor denen man sich aber auch hüten muss, denn auch sie haben den kollektiven Erziehungsauftrag und der wird erfüllt. Dabei ist der Ton schroff-liebevoll: „Ich wer’ die Beene machen!“ und „Ich mach glei’ mit, Freundchen“ (S. 23).
Die meisten Kinder erleben eine glückliche Kindheit; das Kollektiv funktioniert. Im Sommer sind die Kinder gemeinsam im Ferienlager, und alle werden früher oder später „bei Pumpe“ landen. Die Straßen sind nach Kosmonaut*innen benannt, trotzdem landet niemand im All, sondern alle früher oder später in der Grube.
Flucht in die Subkultur
Die dicke Luft des proletarischen Lebens im Realsozialismus atmen die Leser*innen ein, genau wie die frische Luft, die die Subkultur bietet, die es auch in der DDR gab. Lemke beschreibt das Älterwerden ihrer Generation, die Organisation abseits des gesellschaftlichen Plans, den Kampf „um den Erhalt von Ordnung Sicherheit Disziplin. Wir kämpfen auf der Gegenseite.“ (S. 71)
Aus der kinderreichsten Stadt ist eine Stadt geworden, in der ein Siebtel der Einwohnerschaft Jugendliche sind. Diese Jugendlichen finden sich in Jugendklubs ein, eine Lehrerin organisiert ein Singeklub, bei dem ein Schüler besonders heraussticht: Gerhard Gundermann (Jahrgang 1955), der zwar in der Erzählung nicht direkt vorkommt, der aber trotzdem allgegenwärtig im Buch ist.
Die Begeisterung der porträtierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen für den abgedrehten und regellosen Dadaismus und die Selbstinszenierung als eine Art Bohème machen deutlich, dass die wilden 1980er Jahre schon eine Weile zurückliegen. Sie zeigen aber auch, dass es durchaus Schlupflöcher und Möglichkeiten in der ach so biederen DDR gab.
Textzeilen von Gundermanns Lieder ziehen sich durch das Buch und ergänzen den Text der Erzählerin und die O-Töne der vielen Weggefährt*innen Lemkes. Es ist eine eindrucksvolle, stets stimmige sowie vielstimmige Collage, die Lemke geschaffen hat. Als Filmemacherin hat sie das Handwerk der Montage gelernt, als Buchautorin hebt sie diese Kunst auf eine neue Ebene. Es ist beeindruckend, wie die Autorin verschiedene Ebenen locker miteinander verwebt. Sie verzichtet dabei auf eine Ich-Erzählerin, womit sie es sich eigentlich schwerer macht: Hinter einer Ich-Erzählerin kann man sich gut verstecken und vor Widerspruch immunisieren – wer will einem schon die gemachten Erfahrungen absprechen?
Der Horror der Nazis
Während die O-Töne im lokalen Slang daherkommen, Sprichwörter kursiv gesetzt sind und sprachlich hervorstechen, nutzt Lemke den lausitzischen Dialekt manchmal auch im Erzähltext und lässt dadurch den Schlamm der Neustadt, die kollektive Kindererziehung und den jugendlichen Dadaismus lebendig werden. Anschaulich und beklemmend beschreibt Lemke den Horror der rechten Gewalt: die Angst vor den Nazis, die Verzweiflung, das nächste Opfer sein zu können, schließlich die Einsamkeit, weil man sich nicht mehr traut, die Wohnung zu verlassen.
Lemke schreibt bitter und ehrlich über die Vorläufer des Pogroms auf die Unterkünfte der Vertragsarbeiter*innen: „Alles, was wir dabei empfinden ist Erleichterung. Es waren nicht wir, in deren Fenster Steine flogen“ (S. 159). Sie beschreibt schonungslos das Zuschauen, Mitmachen, Beklatschen im September 1991 – und die eigene Ohnmacht, das Wegducken, das Einigeln im selbstverwalteten Jugendklub, dem „Laden“: „Während die Vietnamesen […] um ihr Leben laufen, beschäftigen wir uns im Laden mit der Figur des Hasen bei Beuys.“ (S. 174)
Getriebene Leben
Lemke macht das, was bisher viel zu wenige ihrer Generation aus der DDR gemacht haben: Sie blickt zurück – gefühlvoll, analytisch, selbstkritisch. Die Autorin traut sich, von ihrer Erfahrung zu abstrahieren, und erzählt so ein starkes Stück Gesellschaftsgeschichte – ohne dabei alles zu nivellieren, aber auch ohne nur bei sich kleben zu bleiben.
Den meisten ihrer Zeitgenoss*innen war diese Form der Reflexion bisher nicht vergönnt: Sie hatten kaum Gelegenheit, einmal stehenzubleiben, sich an dem bisher gegangenen Weg zu erinnern, ja, diesen aufzuarbeiten. Die meisten waren und sind Getriebene: Aufgewachsen in einem Land, das täglich die Zukunft beschwor, geriet allen Gewissheiten zum Trotz alles aus den Fugen – sogar die Zeit selbst. Plötzlich gab es weder Morgen noch Gestern, es zählte nur das Hier und Jetzt – Arbeitssuche, Zurechtkommen, Nachbar*innen vermissen, die wegzogen, wegstarben oder Feind*innen wurden, Leben als Kampf; Kampf ums Überleben.
Gerne hätten wir noch mehr erfahren über die Wege und Kämpfe der „Kinder von Hoy“ ab Mitte der 1990er Jahre. Entsprechende Beschreibungen machen im Buch aber nur wenige Seiten aus und sind weniger dicht und tiefsinnig als die grandiosen Zeilen zuvor. Allerdings findet sich in diesem letzten Abschnitt des Buches eine der Stärken Lemkes wieder: ihre Unvoreingenommenheit, indem unumwunden zugegeben wird, dass man auch nicht den Nachfragen der neuen Kinder von Hoy, dem Jahrgang 1988, adäquat antworten kann – oder will. „Aber sie fragen und nerven weiter. Die Antworten, die sie bekommen lauten immer: ’Wir warn’s ni’ ’Wir sind so ni’ ’Sie woll’n uns nur schlechtmachen’ ’Es muss doch ooch ma Ruhe sein’.“ (S. 231).
Es mag sein, dass der Autorin bei diesem wunderbaren Buch am Ende ein wenig die Luft ausgegangen ist, vielleicht hat sie auch bewusst darauf verzichtet, weil die eingeschlagenen Richtungen der Protagonist*innen zu unterschiedlich waren. Vielleicht ist auch einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für Reflexionen über die Jahre nach dem großen Bruch gekommen.
Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror.
Suhrkamp, Berlin.
ISBN: 978-3-518-47172-2.
255 Seiten. 16,00 Euro.